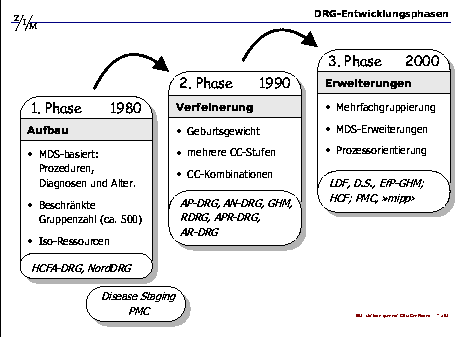|
|
|
Phase 1: Aufbau
|
|
Nur Routine-Daten
|
Ende der 70er Jahre
wurden die «Diagnosis Related Groups» (DRG)
als ein mögliches Modell
zur Produktespezifikation im Akutkrankenhaus vorgestellt.
Sie basierten auf
Prozeduren-Codes, Diagnosen-Codes und Alter.
So konnte die Vorgabe, nur bereits verfügbare Daten zu verwenden,
erfüllt werden, denn
diese Daten wurden
in den USA bereits damals routinemässig gesammelt:
Sie sind Felder im «Minimaldatensatz» (MDS).
|
|
Staatliche Förderung
trotz mangelnder Homogenität
|
Da Kostendaten zu Beginn noch kaum verhanden waren,
verwendete man anstelle dessen meist die Aufenthaltsdauer.
Obwohl nun die Homogenität der DRGs
bezüglich der Aufenthaltsdauer
noch sehr unbefriedigend war,
wurde das System von Staates wegen
zur Vergütung der Behandlung bei Medicare-Versicherten
eingesetzt und gewann damit die Vorherrschaft
gegenüber alternativen Modellen wie «Disease Staging» (D.S.)
und «Patient Management Categories» (PMC).
|
Abb. 1:
DRG-Hauptentwicklungsphasen
| |
| |
|
Phase 2: Verfeinerung
|
|
CC-Verfeinerungen,
um die Kostenhomogenität zu verbessern
|
Aufgrund der Kritik bezüglich der schlechten Homogenität
(und auch der ungenügenden Berücksichtigung von jüngeren Patienten)
wurden seit Ende der 80er Jahre
DRG-Systeme entwickelt, welche eine verfeinerte Klassifikation
mit drei bis vier Ressourcenintensitätsstufen aufwiesen
(«CC-Stufen» oder «CC-Kategorien»;
CC = «Comorbidity or Complication»).
Der Datensatz wurde um das Geburtsgewicht erweitert.
Ansonsten blieb es bei der Verwendung von Prozeduren, Diagnosen
und Alter.
|
|
Einbezug mehrerer Nebendiagnosen
|
In manchen Systemen wurde nur die jeweils gewichtigste Nebendiagnose
jedes Falles zur CC-Kategorisierung benutzt
(u.a. im AP-DRG- und im GHM-System);
in ausgeklügelteren Systemen wurden mehrere Nebendiagnosen
unterschiedlich gewichtet und als «CC-Kombination»
zur CC-Bestimmung benutzt (z.B. im APR-DRG- und im
AR-DRG-System.
|
| |
|
Phase 3: Erweiterung
|
|
Ausbreitung in andere Länder
|
Unterdessen begannen sich DRG-Systeme in andere
Länder auszubereiten.
Teilweise entwickelten sich auch eigenständige Systeme,
die sich jedoch meist recht stark
an das Vorbild der ursprünglichen DRG-Systeme anlehnten.
|
|
Vorsichtiges Loslösen vom amerikanischen Vorbild
|
Obwohl sich die Systeme grosser politischer Beliebtheit erfreuen,
fordert die mangelnde Homogenität nach wie vor die Kreativität
der Entwickler heraus. Allmählich beginnt man sich von der strikten
Vorgabe, nur die amerikanischen Minimaldaten zu verwenden, zu lösen.
Es werden Daten zum IPS-Aufenthalt erhoben und ausgewertet.
Die Kostenrelevanz von Pflegedaten wird studiert.
Andere Ansätze erlauben es, einem Fall mehrere Fallgruppen zuzuordnen.
Teilweise wird dabei auch das Konzept der Hauptdiagnose aufgegeben.
Damit werden (endlich!) Mehrfachbehandlungen abbildbar,
und die Multimorbidität kann aus klinischer Sicht adäquater beschrieben
werden.
|
|
Prozessorientierung
|
Schlussendlich wird versucht, die Entwicklung von
«Guidelines», «Clinical Pathways», usw.
mit der DRG-Entwicklung in Verbindung zu bringen.
Die Schaffung von Möglichkeiten,
DRG-Systeme mit Modellen zur Prozessplanung
und zur Prozessoptimierung zu verknüpfen,
wird entscheidend werden für einen gewinnbringenden
und von allen Beteiligten akzeptierbaren Einsatz
dieser Systeme in Krankenhäusern
sowie in vor- und nachgelagerten Institutionen
in den Versorgungsketten.
|
|
Fehlende Präzisierung
der Falldefinition
|
Die Lösung eines weiteres Problems,
das neben der ungenauen klinischen Beschreibung
ebenfalls zu grossen
Streuungen innerhalb von DRGs
führt, steht noch bevor:
Eine überzeugende Falldefinition.
|